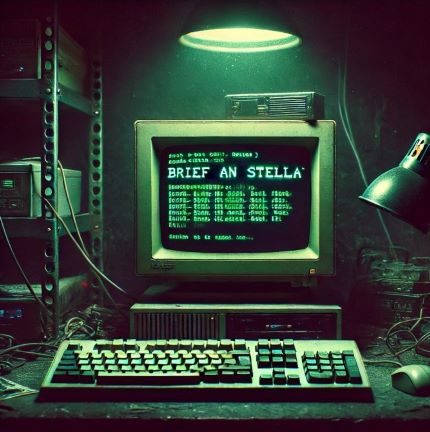Liebe Stella.
Obwohl wir beide uns fest vorgenommen hatten, in Kontakt zu bleiben, ist das passiert, was leider oft geschieht, wenn das gelebte Leben in unterschiedliche Richtungen driftet: Man verliert sich aus den Augen.
Aber in den letzten Tagen habe ich wieder sehr oft an dich gedacht.
Weißt du noch, wie begeistert wir von der Serie Mr. Robot waren?
Was ich heute ein wenig bedaure, ist, dass wir sie nie gemeinsam analysiert haben. Ich war damals überzeugt, dass du sie genauso interpretierst wie ich – was rückblickend, bei dieser Tiefe und Fülle an Bedeutung, ziemlich unwahrscheinlich war.
Ich selbst schrieb damals diese (fast schon oberflächliche) Rezension: Rezension Mr. Robot.
Jetzt – fast fünf Jahre später – habe ich mir die Serie noch einmal angesehen. Und ich beginne zu begreifen, dass ihre Interpretation sehr davon abhängt, in welchem Maß man sich in die Dissoziation – nicht in Elliot selbst, sondern in seine Dissoziation – hineinfühlen kann.
Und das wiederum hängt vielleicht davon ab, in welchem Dissoziationsstadium man sich selbst gerade befindet.
Damals habe ich das Ende der Serie nicht wirklich erfasst.
Ich habe mit aller Kraft versucht, den Coder festzuhalten.
Ich wollte ihn nicht gehen lassen – denn er war derjenige, in dem ich mich zu hundert Prozent wiedergefunden habe.
So wie er versuche auch ich, der Machtlosigkeit etwas entgegenzusetzen. Kontrolle zu gewinnen. Halt zu finden.
Oft befinde ich mich noch heute in diesem Zustand:
Die, die ständig denkt, weil Fühlen zu gefährlich ist.
Kontrolle. Klarheit.
Ein Schutzpanzer.
Der stille Zuschauer meiner selbst.
Analyse und Vergleiche
Spätestens in der vierten Staffel steigen viele Zuschauer aus – oder sie verlieren die Orientierung: Was ist noch real? Was findet nur in Elliots Kopf statt? Beispiele:
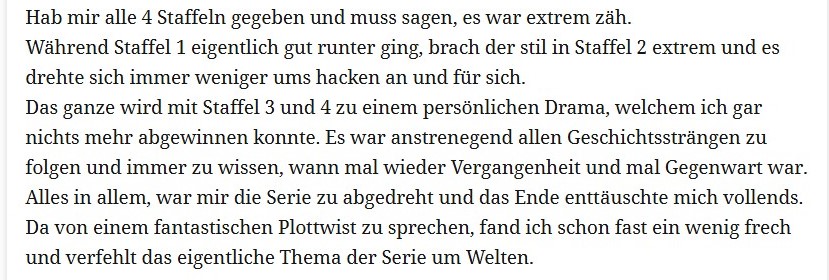
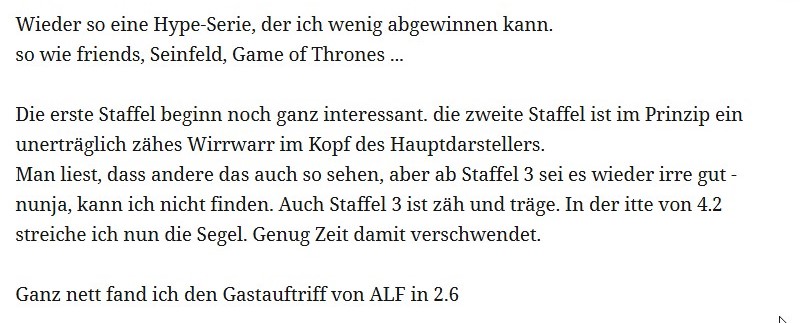
Natürlich gibt es auch begeisterte Kommentare.
Aber sehr viele haben deutlich gemacht, dass sie mit den Abläufen überfordert waren.
Ich selbst habe mir die vierte Staffel in den letzten Tagen mehrfach angesehen.
Vor allem Folge 7 (407 Proxy-Authentifizierung erforderlich) enthält eine der intensivsten und intimsten Szenen der gesamten Serie: Elliot in einem Therapiesetting – konfrontiert mit einer verstörenden Erinnerung, Krista, seiner Therapeutin, und einem mutmaßlichen Täter.
Auf den ersten Blick wirkt diese Szene vollständig innerlich: keine Geräusche von außen, keine Schnitte, kein Bezug zur Welt. Alles scheint sich auf einer psychischen Bühne abzuspielen, in einem symbolischen Raum, in dem Elliot mit sich selbst ringt.
Doch es gibt eine tiefere Deutung – eine, die zeigt, wie real und innerlich zugleich diese Szene sein kann: Was, wenn diese Therapiesitzung tatsächlich stattgefunden hat – aber nicht die Realität in Elliots Kopf drang, sondern die Sitzung in seine Innenwelt hinein? Diese Perspektive erschafft eine dritte Ebene der Deutung – jenseits von „nur symbolisch“ oder „nur real“.
Wenn ein Mensch wie Elliot schwer dissoziiert, verschwimmen die Grenzen zwischen Außen und Innen. Eine reale Therapiesitzung – in einem physischen Raum mit einer realen Therapeutin – wird durch innere Prozesse wie Abwehr, Fragmentierung und symbolische Repräsentation gefiltert.
Das bedeutet:
- Der Täter ist nicht notwendigerweise physisch anwesend, sondern erscheint als innere Projektion des Traumas.
- Krista ist vielleicht wirklich da – aber was wir sehen, ist Elliots Wahrnehmung von ihr,
verdichtet auf ihre Rolle als Konfrontationsfigur. - Der Raum selbst – leer, neutral, emotionslos – wird zum psychischen Container.
Diese Szene ist dann nicht „nicht real“.
Sie ist hyperreal – weil sie das Geschehen so zeigt, wie es sich für Elliot anfühlt.
Intrusion trifft Rekonstruktion:
Das reale Erleben (Sitzung, Gespräch) trifft auf die innere Architektur von Elliot.
Seine Innenwelt nimmt das Geschehen auf – und baut es um, so wie das Ich es ertragen kann.
Es entsteht ein dissoziativer Wahrnehmungsraum, in dem:
- Realität existiert, aber fragmentiert
- Wahrheit geschieht, aber durch den Filter von Schutzsystemen
- Erinnerung sich formt, aber als Rekonstruktion im inneren Symbolraum
Diese Szene ist nicht der Moment, in dem Elliot „halluziniert“ – sondern der Moment, in dem er beginnt, die äußere Wahrheit durch seine innere Welt zuzulassen.
Ein realer Raum.
Ein innerer Prozess.
Ein seelischer Durchbruch.
Und vielleicht – für alle, die Dissoziation kennen – ein stiller Spiegel der eigenen Wahrnehmung.
Einziger Kritikpunkt.
So meisterhaft die Serie Mr. Robot in ihrer erzählerischen Tiefe, ihrem psychologischen Feingefühl und ihrer visuellen Symbolik auch ist – am Ende bleibt ein kleiner Stachel zurück.
Ein Stachel, der vielleicht nur denen auffällt, die selbst zu lange mit innerer Zersplitterung, Identitätsdiffusion oder psychischer Schutzarchitektur gelebt haben.
Denn: Elliot wird – bei aller Komplexität – am Ende doch noch in eine Schablone gepresst.
Die Serie versucht, seine inneren Anteile, seine tiefe Fragmentierung und sein jahrelanges Leiden mit einem einzigen Erlebnis zu erklären: dem sexuellen Missbrauch durch seinen Vater.
Ja – dieses Trauma ist erschütternd, tabuisiert, schwer.
Aber es ist auch eine psychologische Vereinfachung, die dem Zuschauer ein „Aha“ geben soll – während Elliot selbst nie so einfach zu entschlüsseln war.
Dass ausgerechnet diese Erklärung gewählt wird – eine, die im heutigen Therapiediskurs fast schon dogmatisch verwendet wird – ist schade.
Denn sie nimmt Elliot ein Stück seiner Universalität.
Sie reduziert ihn auf ein Muster, das in seriösen Fachkreisen längst kritisch hinterfragt wird:
DIS = sexueller Missbrauch in der Kindheit
Dabei wissen wir längst:
Auch emotionale Vernachlässigung kann zersplittern.
Auch Isolation. Bindungsabbruch. Kontrollverlust. Existenzielle Unsicherheit.
Auch die stille Unsichtbarkeit eines Kindes kann eine Innenwelt hervorbringen, die sich teilt, flüchtet, schützt.
Elliot war so viel mehr.
Ein Mosaik aus Kontrolle, geistiger Brillanz, moralischer Zerrissenheit, emotionalem Hunger, paranoider Hyperwachsamkeit – und gleichzeitig tiefer Verletzlichkeit.
Ein Mensch, keine Diagnose.
Vielleicht ist es dieser eine kleine Kompromiss, der zeigt, wie sehr selbst ein mutiger Regisseur wie Sam Esmail am Ende eine Brücke zur Masse bauen muss.
Für viele ist das nachvollziehbar.
Für manche – wie mich – bleibt es ein zarter Wermutstropfen in einem ansonsten radikal ehrlichen Meisterwerk.